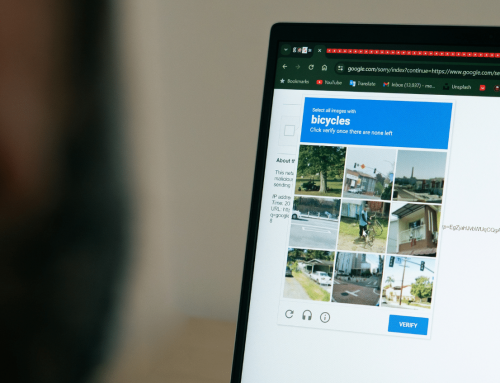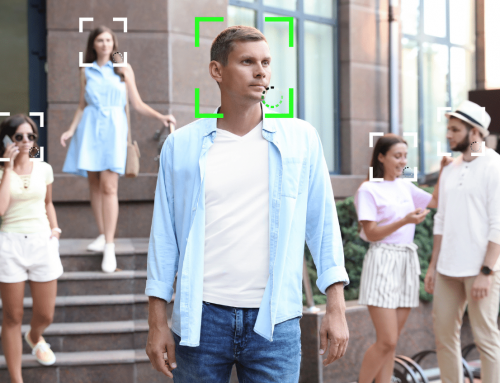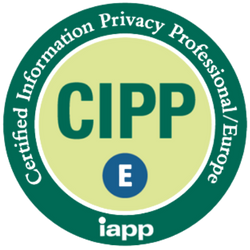Bild: Photo Agency / Shutterstock.com
Was OpenAI und SAP jetzt planen – und warum das (fast) alles verändert
Deutschland steht vor einer digitalen Zeitenwende: Der US-amerikanische KI-Riese OpenAI und Europas Software-Schwergewicht SAP haben einen Deal geschlossen, der Verwaltungen, Schulen und Universitäten im ganzen Land auf ein neues technologisches Level heben soll. Ab 2026 soll Schluss sein mit Aktenbergen, Formular-Wahnsinn und Verwaltungsstau – stattdessen soll Künstliche Intelligenz (KI) helfen, Aufgaben schneller und effizienter zu erledigen.
Julie Lavet, Europa-Chefin von OpenAI, bringt es auf den Punkt: „Deutschland wird damit einen Zugang zu den besten Technologien zu deutschen Bedingungen erhalten.“ Die Idee klingt mächtig: Millionen Mitarbeitende in Behörden, Forschungseinrichtungen und Bildungseinrichtungen sollen künftig mit KI arbeiten – nicht als Spielerei, sondern als echte Arbeitshilfe.
Weniger Papierkram, mehr Zeit für Menschen
OpenAI und SAP verfolgen ein gemeinsames Ziel: Millionen Beschäftigte in Verwaltungen, Forschungseinrichtungen und öffentlichen Institutionen sollen ab 2026 in die Lage versetzt werden, Künstliche Intelligenz sicher und verantwortungsvoll zu nutzen. Damit sollen tägliche Aufgaben schneller erledigt, die Aktenführung automatisiertund Bürgerdienste verbessert werden. Laut den Unternehmen entsteht dadurch mehr Zeit für die Arbeit am Menschen statt für Papierkram.
Die geplante Zusammenarbeit richtet sich an Verwaltungen, Schulen, Universitäten und weitere öffentliche Einrichtungen in Deutschland. OpenAI-Managerin Julie Lavet betont, dass Deutschland damit Zugang zu den besten Technologien zu deutschen Bedingungen erhält.
Deutsche Regeln, amerikanische Technik – kann das gutgehen?
So revolutionär das Projekt ist – es hat einen Haken: Die Technik kommt überwiegend nicht aus Deutschland. Die Cloud-Lösung basiert auf Microsoft Azure, betrieben wird sie in den Rechenzentren der SAP-Tochter Delos, und die Server laufen auf Nvidia-Chips – allesamt Produkte aus den USA. Auch OpenAI selbst sitzt in San Francisco.
Trotzdem betonen die Projektverantwortlichen immer wieder: Das Ganze sei ein „vollständig souveränes Angebot“, das streng nach deutschen Datenschutzvorgaben funktioniere. SAP-Manager Philipp Herzig erklärt: „Auf die Daten können Unberechtigte nicht zugreifen, weil diese innerhalb der deutschen Rechenzentren verbleiben.“ Auch der Chef von Microsoft, Satya Nadella, wirbt für das Vertrauen in die Lösung: „Verantwortungsvoll und sicher“ solle die KI in Deutschland arbeiten – trotz US-Technik.
Ist das wirklich souverän?
Ehrlich gesagt: Das riecht nach einem Kompromiss, der mehr PR als echte Souveränität ist. Die Rechenzentren stehen zwar in Deutschland, aber Technik und Kontrolle kommen aus den USA. Der Hinweis auf Datenschutz „Made in Germany“ sollte nicht zur Ausrede werden, um Abhängigkeiten schönzureden. Wenn Deutschland wirklich eine digitale Vorreiterrolle übernehmen will, braucht es mehr als schöne Versprechen: eigene Technik, eigene Infrastruktur und echte Kontrolle – sonst bleibt die KI-Revolution ein Export aus dem Silicon Valley mit deutscher Bedienungsanleitung.