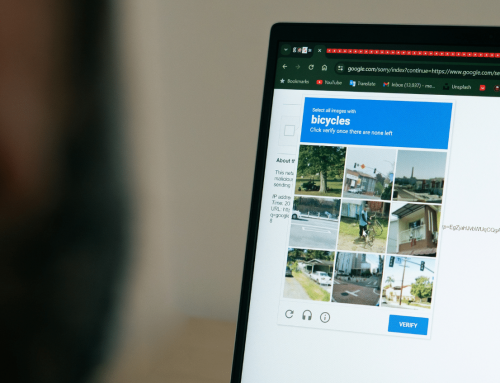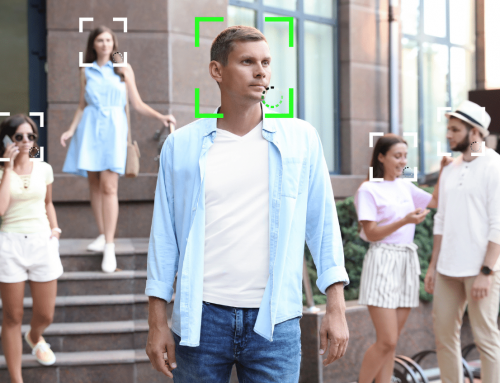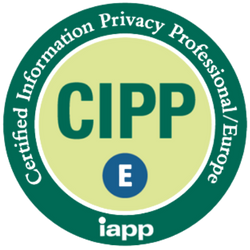Hochglanz-Schrott: Wenn Texte nur so tun, als wären sie nützlich
Künstliche Intelligenz sollte unser Arbeitsleben leichter machen. Stattdessen sorgt sie in vielen Fällen für Frust, Mehrarbeit und Kostenexplosionen. Der neueste Begriff aus der Forschung: „Workslop“ – das klingt wie ein schlechter Witz, ist aber bittere Realität in vielen Unternehmen. Gemeint sind KI-generierte Inhalte, die zwar auf den ersten Blick professionell wirken, aber inhaltlich kaum etwas taugen. Sie sehen gut aus, sagen aber wenig bis gar nichts aus.
Eine aktuelle Studie von Betterup Labs und dem MIT Media Lab zeigt, wie sehr dieser digitale Schrott Unternehmen lähmt. 40 Prozent der befragten Mitarbeiter gaben an, im letzten Monat regelmäßig solchen Datenmüll erhalten zu haben. Ganze 15,4 Prozent der gesamten Arbeitsinhalte bestehen laut Studie inzwischen aus „Workslop“. Das ist mehr als jeder siebte Inhalt!
Zwei Stunden Arbeit für Nichts
Das wirklich Gefährliche an Workslop: Die Texte sind so gut verpackt, dass man ihre Inhaltsleere oft erst beim zweiten oder dritten Lesen bemerkt. Das kostet Zeit. Im Schnitt müssen Mitarbeiter zwei Stunden pro Workslop-Fall investieren – für Nachrecherche, Rückfragen und Klärung. Rechnet man das hoch, ergibt sich ein monatlicher Schaden von 186 Euro pro Kopf. Und das nur für die verlorene Arbeitszeit – von Nerven, Energie und Teamfrust ganz zu schweigen.
Denn Workslop ist nicht nur ein Produktivitätskiller. Er schadet auch dem Betriebsklima. Die Hälfte der Befragten schätzt Kollegen, die solche Inhalte verbreiten, plötzlich als weniger kompetent und weniger vertrauenswürdig ein. Das Vertrauen im Team sinkt, die Zusammenarbeit leidet. Besonders hart trifft es Branchen mit hohem Digitalisierungsgrad – etwa Tech-Konzerne und Dienstleister.
Wenn alle KI nutzen, aber niemand weiß wie
Die Ursache? Unternehmen, die auf KI setzen, ohne ihren Mitarbeitern klar zu sagen, wie, wann und wozu sie die Tools sinnvoll einsetzen sollen. Statt gezielter Hilfe gibt es Copy-and-Paste-Kultur. Jeder macht, was er will – Hauptsache, es sieht irgendwie „smart“ aus. Die Folge: viel heiße Luft, wenig Substanz.
Die Lösung der Studienautoren ist simpel, aber entscheidend: Klare KI-Regeln statt blinden Aktionismus. Wer KI einsetzen will, muss definieren, wofür genau. Generative KI sollte den Menschen unterstützen – nicht ersetzen. Erst dann entfaltet sie ihr Potenzial. Derzeit aber bleibt der große KI-Traum oft ein Produktivitätstraum in Dauerschleife.
Eine gefährliche Illusion: Mehr Schein als Sein
Was bleibt, ist ein teures Missverständnis. Während weltweit Milliarden in KI-Projekte fließen, verpufft der Nutzen. Laut einer MIT-Studie berichten 95 Prozent der Unternehmen von keinem messbaren Gewinn durch ihre KI-Investitionen. Nur fünf Prozent der Projekte bringen bislang überhaupt etwas. Der Rest? Pilotphasen ohne Ende – und jede Menge PowerPoint-Präsentationen mit viel Hoffnung und wenig Wirkung.
Kritik statt KI-Hype?
KI sollte kein Selbstzweck sein – und auch kein digitaler Anstrich für alte Probleme. Wer nur auf schicke Tools setzt, aber keine klare Linie verfolgt, produziert am Ende nur eines: modernen Bullshit. Und der kostet nicht nur Geld, sondern auch Vertrauen. Es ist höchste Zeit, dass Unternehmen ihre KI-Strategien nicht den Marketingabteilungen überlassen – sondern den Menschen, die damit arbeiten sollen.