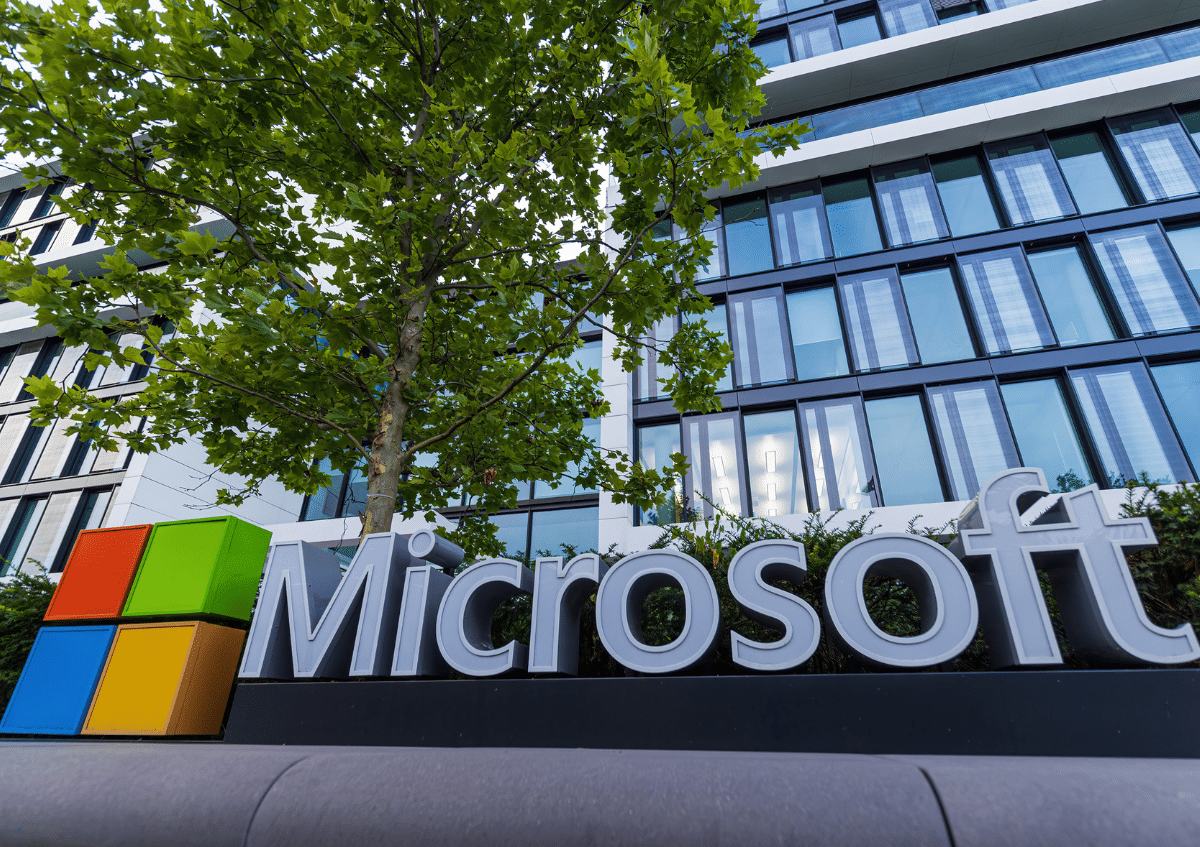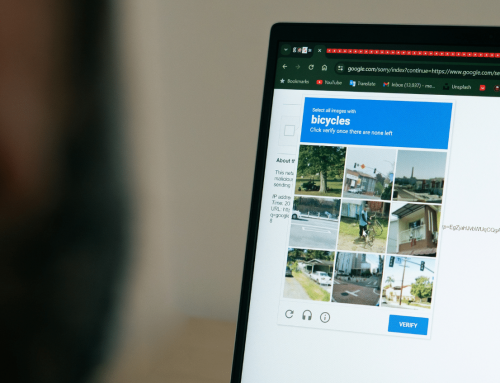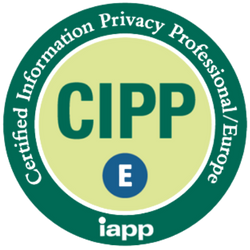Bild: Framalicious / shutterstock.com
KI wird zur Machtfrage – auch vor Gericht
Eine Sammelklage aus San Francisco bringt derzeit mächtig Wirbel in die Welt der künstlichen Intelligenz. Der Vorwurf: Microsoft soll durch seine enge Partnerschaft mit OpenAI die Preise für KI-Dienste künstlich hochgetrieben haben. Die Klage richtet sich direkt gegen den Tech-Giganten – OpenAI ist zwar nicht offiziell Beklagter, steht aber in der Kritik mit auf dem Podium.
Was steckt dahinter? Laut der Klageschrift soll Microsoft durch exklusive Verträge mit OpenAI und den Zugriff auf enorme Rechenressourcen via Azure das Angebot künstlich verknappt haben. Die Folge: Weniger Wettbewerb, höhere Preise – und ein riesiger Vorteil für Microsoft. Die elf Kläger fordern jetzt Schadensersatz für all jene, die seit der ChatGPT-Einführung im November 2022 angeblich zu viel für KI-Dienste zahlen mussten.
Azure, Copilot, ChatGPT: Wenn alles zusammenhängt
Der Hintergrund ist komplex – aber hochspannend: Microsoft hat mittlerweile über 13 Milliarden Dollar in OpenAI investiert, vor allem in Form von Cloud-Leistung über die hauseigene Plattform Azure. Gleichzeitig fließen die GPT-Modelle von OpenAI direkt in Microsoft-Produkte wie Copilot, also in Word, Excel & Co. So profitieren beide – Microsoft wird zum KI-Platzhirsch, OpenAI kann auf eine sichere Infrastruktur bauen.
Doch genau diese Nähe ist jetzt das Problem. Die Kläger werfen Microsoft vor, durch die Exklusivität den Zugang zu Rechenleistung für andere Anbieter blockiert zu haben – ein klarer Verstoß gegen das US-Kartellrecht, wenn der Vorwurf stimmt. Brisant: Auch wenn OpenAI inzwischen begonnen hat, Rechenleistung etwa von Google oder Oracle zu nutzen, sei Microsofts Einfluss nach wie vor „ein Damoklesschwert“, wie es in der Klageschrift heißt.
Worum es wirklich geht: Macht über das Zukunftsprodukt
KI ist längst mehr als ein technisches Spielzeug – sie ist das Zukunftsgeschäft der Tech-Industrie. Wer hier die Regeln diktiert, kontrolliert nicht nur Software, sondern ganze Märkte. Cloud-Kapazitäten sind dabei der Rohstoff, ohne den keine KI läuft. Und wer diesen Rohstoff bündelt, hat Marktmacht – genau das werfen die Kläger Microsoft jetzt vor.
Dass OpenAI versucht, sich von Microsoft unabhängiger zu machen – zum Beispiel durch Kooperationen mit Oracle – zeigt, dass selbst das KI-Vorzeige-Start-up sich nicht wohl fühlt, wenn ein Tech-Gigant zu viel Einfluss hat.
Microsoft gibt sich gelassen. Eine Sprecherin ließ verlauten, man werde die Vorwürfe „prüfen“. OpenAI schweigt. Und die Kläger? Sie warten auf den Gerichtstermin.
Wenn sich Kartellrecht mit KI mischt, wird’s spannend – und ungemütlich
Der Fall zeigt, was viele lange befürchtet haben: Der Wettlauf um KI ist nicht nur ein technologischer, sondern längst auch ein Machtkampf – mit potenziell illegalen Mitteln. Wenn ein einzelnes Unternehmen nicht nur die Software, sondern auch die Infrastruktur kontrolliert, ist das ein strukturelles Problem. Und die Frage, wer künftig KI entwickelt, nutzt und verkauft, wird damit zur politischen und rechtlichen Kernfrage.
Dass die Preisgestaltung von KI-Diensten nicht nur mit technischen Faktoren, sondern womöglich auch mit strategischer Marktabschottung zu tun hat, ist mehr als nur ein Nebenschauplatz. Es geht um den Zugang zu einem Zukunftsmarkt – und darum, ob dieser Markt wenigen Tech-Giganten gehört oder offen bleibt.
Kartellverfahren sind langwierig. Aber eines ist schon jetzt klar: Wenn Microsofts KI-Imperium ins Wanken gerät, wird sich nicht nur die Preisfrage stellen, sondern auch die Machtfrage. Und das ist bitter nötig.