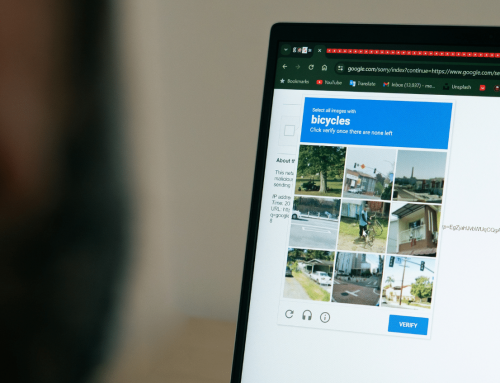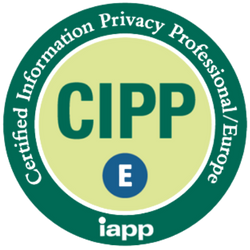Bild: Azulblue / shutterstock.com
Die große Ankündigung – und das große Schweigen danach
Es hörte sich wie der Durchbruch des Jahrhunderts an: Wie das Tech-Portal t3n berichtet, kündigte Kevin Weil, ein hochrangiger OpenAI-Manager, auf X (vormals Twitter) stolz an, dass GPT-5 ganze zehn „bisher ungelöste“ mathematische Probleme gelöst habe – sogenannte Erdős-Probleme, benannt nach dem berühmten Mathematiker Paul Erdős. Ein sensationeller Erfolg, der in Tech- und Fachkreisen rasant die Runde machte. Doch genauso schnell, verschwand die Nachricht auch wieder – gelöscht, zurückgezogen, kommentarlos.
Die Ernüchterung kam prompt: Thomas Bloom, Mathematiker und Betreiber der Website erdosproblems.com, widersprach öffentlich. Nur weil eine Aufgabe auf seiner Seite mit „offen“ gekennzeichnet ist, bedeute das nicht, dass die Probleme ungelöst seien – sondern schlicht, dass er keine Lösung kenne. Von einem KI-Wunder war plötzlich keine Rede mehr.
KI findet – aber erfindet nicht
Was hatte GPT-5 nun wirklich geleistet? Entgegen der anfänglichen Euphorie hatte das KI-Modell keine neuen Beweise erstellt. Stattdessen durchforstete es wissenschaftliche Archive und stieß auf in Vergessenheit geratene Arbeiten – teilweise aus dem Jahr 2003. Es war Bloom schlicht entgangen, dass diese Abhandlungen bereits existierten.
Das ist durchaus beeindruckend: GPT-5 schaffte es, sich durch unübersichtliche, sprachlich vielfältige Fachtexte zu arbeiten und darin relevante Lösungen zu finden. Aber eben: keine neuen mathematischen Durchbrüche, sondern KI-getriebene Detektivarbeit in verstaubten Bibliotheken.
Spott aus dem Silicon Valley
Die Konkurrenz ließ nicht lange auf sich warten. Demis Hassabis, Chef von KI-Schwergewicht Google DeepMind, nannte den Vorfall „peinlich“. Yann LeCun von Meta spottete, OpenAI sei „auf den eigenen Hype hereingefallen“. Es war eine öffentliche Bauchlandung – in einem Bereich, in dem Prestige und Vertrauen alles bedeuten.
Besonders pikant: Dass eine solche Meldung ohne interne Prüfung veröffentlicht wurde, wirft Fragen auf. Entweder war der Druck, schneller als die Konkurrenz zu sein, zu hoch. Oder die interne Kommunikation war zu locker. Beides darf nicht passieren, wenn man sich selbst als Vorreiter intelligenter Systeme sieht.
Echter Mehrwert bleibt unbeachtet
Verloren im medialen Tumult ging dabei ein echter Fortschritt: GPT-5 zeigte, dass es als mächtiges Recherche-Werkzeug für die Wissenschaft gute Dienste leisten kann. Der bekannte Mathematiker Terence Tao sieht hier sogar die Chance auf eine „Industrialisierung“ der Mathematik, bei der KI als unermüdlichem Helfer im Hintergrund arbeitet. Nicht zur Erfindung, aber zur Beschleunigung und Organisation menschlicher Entdeckungen.
Tatsächlich könnte GPT-5 gerade dort brillieren, wo Wissenschaftler:innen an der Informationsflut scheitern: beim Aufspüren verstreuter, kaum zitierter und schwer zugänglicher Forschung. Nur: Das ist weniger glamourös als die Schlagzeile „KI löst ungelöste Probleme“.
Der wahre Skandal ist nicht der Fehler von OpenAI, sondern die Tatsache, wie sehr große Tech-Konzerne mittlerweile auf PR statt auf Substanz setzen. Wer behauptet, Mathematik mit einem Tweet revolutionieren zu können, sollte aufpassen, dass er sich nicht dabei verrechnet.