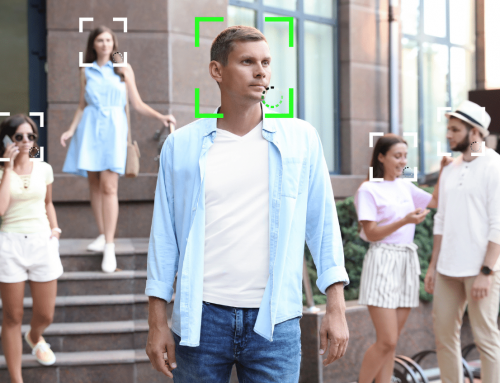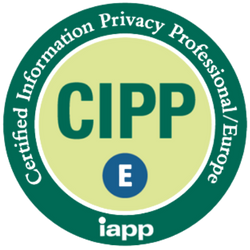Bild: Alex Photo Stock / shutterstock.com
Wenn der Chatbot plötzlich als Zeuge aussagt
Ein 19-jähriger Student aus den USA dachte wohl, er könnte sich bei ChatGPT Luft machen – und landete damit hinter Gittern. Was eigentlich wie ein vertrauliches Selbstgespräch mit der Künstlichen Intelligenz klang, wurde später zum Beweisstück Nummer Eins. Der Vorwurf: massive Sachbeschädigung. Der Tatort: ein Campusparkplatz.
Laut dem US-Portal „The Smoking Gun“ beschädigte der Student mitten in der Nacht 17 Autos – zertrümmerte Scheiben, zerstörte Spiegel, eingedrückte Motorhauben. Die Polizei fand am Ort des Geschehens Schuhabdrücke, Kamerabilder und Standortdaten seines iPhones. Doch was wirklich den Ausschlag gab, war sein eigener Chatverlauf mit ChatGPT.
Sein verzweifelter Wortwechsel begann harmlos: „Wie sehr bin ich am Arsch?“ Dann folgte die fast schon klassische Frage: „Werde ich ins Gefängnis kommen?“ Und schließlich das digitale Geständnis: „Ich hab’ all diese nutzlosen Scheißautos kaputt gemacht!“
Für die Ermittler war das ein Volltreffer. Digitale Beichte gleich Schuldeingeständnis – der Student wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.
KI statt Beichtstuhl: Ist das jetzt der neue Ermittler?
Der Fall wirft brisante Fragen auf: Wenn wir uns mit einer KI unterhalten, ist das dann noch privat? Oder liest da längst jemand mit – im Zweifel die Polizei?
In den USA durften die Ermittler den Chat nur deshalb verwenden, weil der Student der Durchsuchung seines Handys zugestimmt hatte. In Deutschland wäre das ohne richterlichen Beschluss ebenfalls kaum möglich – zumindest in der Theorie. Denn: Das sogenannte Selbstbelastungsprivileg schützt hierzulande davor, sich selbst zu belasten, zum Beispiel durch Herausgabe der PIN.
Aber Vorsicht: Wer sein Handy mit Gesicht oder Fingerabdruck entsperrt, hat diesen Schutz nicht unbedingt. Das Oberlandesgericht Bremen hat Anfang 2025 klargestellt: Ermittler dürfen den Finger eines Verdächtigen auf das Display drücken, um das Handy zu entsperren – rechtlich abgesichert durch § 81b Strafprozessordnung.
Smartphones als offene Bücher – und wir schreiben mit
Was früher das Tagebuch war, ist heute der Smartphone-Chat. Nur dass er nicht in der Schublade liegt, sondern jederzeit digital ausgelesen werden kann – von wem auch immer.
Dass ausgerechnet ein Chat mit einer KI zur Verurteilung führen kann, ist ein neuer Meilenstein. Kein Mensch hat ihn verpfiffen, keine Kamera ihn direkt bei der Tat gefilmt – er hat sich selbst belastet, freiwillig, digital, ausgerechnet gegenüber einer Maschine.
Kein Gespräch, sondern ein gespeicherter Datensatz
Wer sein Gewissen bei einer KI erleichtert, sollte sich nicht wundern, wenn es bald juristische Konsequenzen hagelt. Der Fall zeigt, wie gefährlich das Gefühl von digitaler Vertraulichkeit sein kann. Was sich wie ein Selbstgespräch anfühlt, ist in Wahrheit ein speicherbarer Datensatz.
Technologie verzeiht nicht – sie erinnert sich. Wer glaubt, ChatGPT sei ein digitaler Freund mit Schweigepflicht, täuscht sich gewaltig. Es ist keine Beichte, es ist ein Protokoll. Und manchmal eben auch eine Eintrittskarte ins Gefängnis.