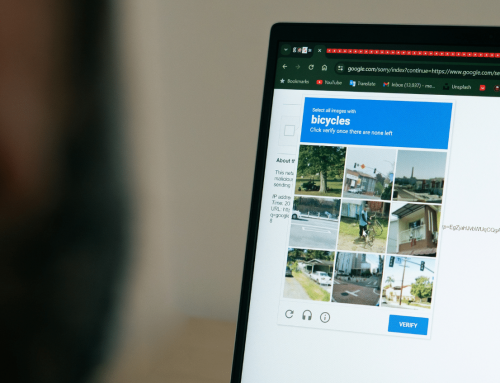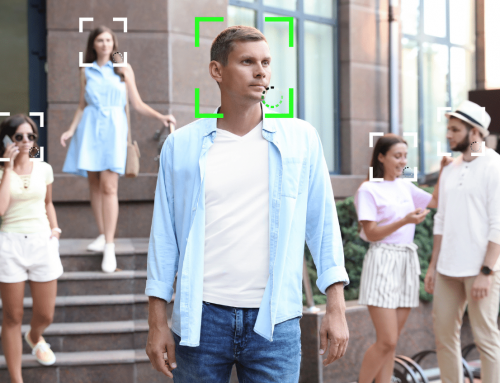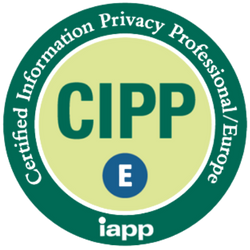Ein kleiner Finger für die Justiz – ein riesiger Schritt für die Strafverfolgung
Wer heute ein Smartphone in der Tasche hat, trägt sein halbes Leben mit sich herum. Chats, Fotos, Bankdaten, Passwörter – alles liegt hinter einem Code, Fingerabdruck oder Gesichtsscan. Bisher galt: Wer nicht entsperren will, kann nicht gezwungen werden, sein Wissen – also die PIN – preiszugeben. Doch der Bundesgerichtshof (BGH) hat nun entschieden: Dein Finger gehört dir, aber er darf gegen dich verwendet werden.
Das Urteil (Az. 2 StR 232/24) erlaubt den Strafverfolgungsbehörden, die Finger eines Beschuldigten mit Gewalt auf den Sensor zu legen, um ein Smartphone zu entsperren. Grundlage dafür? Eine Mischung aus mehreren Paragraphen der Strafprozessordnung – kreativ kombiniert.
Wenn Paragraphen zurechtgebogen werden
Der BGH stützt sich vor allem auf § 81b Abs. 1 StPO, eine Regel, die eigentlich erkennungsdienstliche Maßnahmen erlaubt – also Dinge wie Fotos, Fingerabdrücke oder ähnliche Methoden, um die „körperliche Beschaffenheit“ festzustellen. Das Problem: Die Norm erlaubt die Erfassung, nicht die Nutzung dieser Merkmale, um an komplett andere Daten zu gelangen.
Doch der BGH sagt: Technik entwickelt sich, und die Vorschrift sei „technikoffen“. Also dürfe man den Fingerabdruck auch für das Entsperren nutzen – schließlich diene das der „Durchführung des Strafverfahrens“. Kritiker wie Jurist Felix Ruppert sehen darin den gefährlichen Versuch, eine Norm zum Allzweckwerkzeug zu machen. Denn mit dieser Logik ließe sich fast jede Ermittlungshandlung rechtfertigen.
Vom Finger zum kompletten Datenzugriff
Der Unterschied ist gewaltig: Ein Foto oder Fingerabdruck verrät wenig. Ein entsperrtes Smartphone kann alles verraten – Bewegungsprofile, private Gespräche, intime Bilder. Deshalb ist der Eingriff auch viel tiefer und berührt das vom Bundesverfassungsgericht geschützte IT-Grundrecht. Für solche massiven Zugriffe braucht es eigentlich eine klar geregelte, speziell zugeschnittene Rechtsgrundlage.
Der BGH versucht, diesen Mangel mit einer „Normenkette“ aus §§ 94 ff. StPO und einer richterlich angeordneten Durchsuchung zu überbrücken. Das Ergebnis: ein juristisches Flickwerk, das mehr Fragen offenlässt als beantwortet.
Die Tür ist offen – auch für Gesicht und Iris
Wenn der Finger so eingesetzt werden darf, was ist dann mit dem Gesicht? Oder einem Iris-Scan? Juristisch betrachtet steht die Tür jetzt weit offen. Der Weg zur „Universalermächtigung“ wäre geebnet – eine Entwicklung, die Datenschutzexperten und Verfassungsrechtler alarmiert.
Felix Ruppert bringt es auf den Punkt: Das Erschaffen neuer Befugnisse ist Aufgabe des Gesetzgebers, nicht der Gerichte. Nur so könne sichergestellt werden, dass Grundrechte ausreichend berücksichtigt werden.
Kreative Auslegung mit bitterem Beigeschmack
Die Polizei bekommt ein mächtiges Werkzeug in die Hand – ohne dass der Gesetzgeber die nötigen Schranken gesetzt hat. Für Bürgerinnen und Bürger bedeutet das: Wer sein Smartphone per Finger oder Gesicht schützt, muss damit rechnen, dass diese Sicherheitsbarriere auf richterlichen Beschluss hin ausgehebelt wird. Unser Tipp: Wenn schon biometrische Sperre, dann als Zweitfaktor – und die eigentliche Zugangssperre über eine starke PIN oder ein Passwort. Das ist nicht nur sicherer, sondern schützt auch vor allzu neugierigen Blicken der Strafverfolgung.